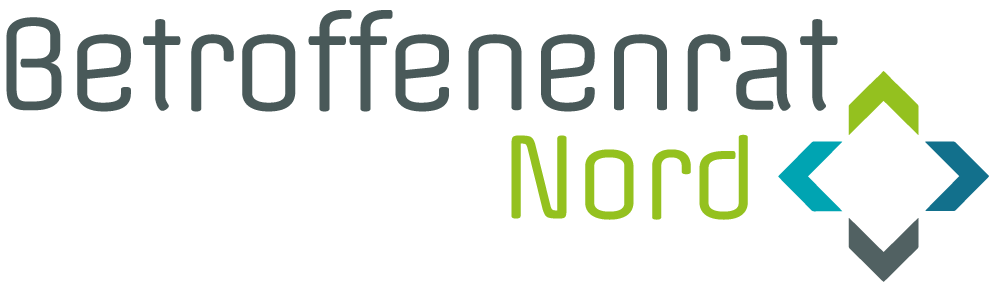Hilfen bei Missbrauch
Auf dieser Seite finden Sie folgende Hilfen:
Hilfe-Telefone
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch
24 Stunden, 7 Tage die Woche
Hilfe-Telefon berta
Beratung bei organisierter sexueller und ritueller Gewalt, UBSKM
Opfer-Telefon Weißer Ring e. V.
Medizinische Kinderschutz-Hotline
Beratungsangebot für Fachpersonal bei Kinderschutzfragen
Welche Anträge kann ich stellen? Welche Rechte habe ich?
Als Betroffener sexualisierter Gewalt durch Angehörige der katholischen Kirche können Sie einen „Antrag auf Anerkennung des Leids“ stellen. Die Leistungen erstrecken sich auf Geldzahlungen und die Übernahme von Therapiestunden (Einzel- und Paartherapie).
Da Sie Opfer einer Gewalttat wurden, die gesundheitlichen Schaden verursacht hat, können Sie Versorgungsleistungen nach SGB XIV beantragen (ersetzt seit 1.1.24 das Opferentschädigungsgesetz). Nun können auch Opfer psychischer Gewalttaten, (vernachlässigte) Kinder, Opfer im Bereich der Kinderpornografie sowie Angehörige und Hinterbliebene Entschädigungsleistungen geltend machen. Das Gesetz gilt grundsätzlich für Ansprüche aus Taten, die nach dem 15. Mai 1976 begangen worden sind. Für zuvor begangene Taten gelten einschränkende Bedingungen.
Wer als Kind oder Minderjährige:r sexualisierte Gewalt im institutionellen oder familiären Kontext erleben musste, benötigt oft Unterstützung über gesetzliche oder kirchliche Leistungen hinaus. Hier kann der Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) auf Antrag helfen.
Psychische Erkrankungen werden als Behinderungen anerkannt: Nicht nur "sichtbare" Behinderungen sind relevant. Auch mit einer unsichtbaren Behinderung, etwa einer schweren chronischen Erkrankung, einer seelischen oder psychischen Erkrankung kann man den Grad der Behinderung (GdB) feststellen lassen. Dieser kann (je nach Höhe) z. B. Auswirkungen auf Steuerfreibeträge, den Kündigungsschutz und andere Nachteilsausgleiche haben.
Gegenüber sämtlichen Institutionen, so auch gegenüber der Kirche und der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA), haben Sie ein Recht auf Auskunft über die Daten, die über Sie gespeichert und verarbeitet werden. Auf Antrag müssen Ihnen diese innerhalb von vier Wochen in Kopie zugesendet werden.
Antrag auf Anerkennung des Leids
Wurden Sie Opfer sexuellen Missbrauchs durch kirchliche Mitarbeiter?
Hier ist, was Sie jetzt tun können:
Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Verfahren zur Anerkennung des Leids eingesetzt. Personen, die als Minderjährige oder erwachsene Schutzbefohlene sexuellen Missbrauch durch Personen im kirchlichen Dienst (Priester, Ordensleute, Diakone, Küster, Lehrer etc.) erlebt haben, können einen Antrag auf Anerkennung des Leids stellen - unabhängig davon, ob sie das Verfahren zur Anerkennung des Leids in der alten Version schon durchlaufen haben oder nicht; unabhängig davon, ob die Taten strafrechtlich verjährt (und/oder die Täter verstorben) sind oder nicht. Betroffene stellen über die Ansprechpersonen bei den Bistümern oder Orden einen Antrag bei der Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA). Die UKA legt eine Leistungshöhe fest und veranlasst die Auszahlung des Gelds an die Betroffenen. Eine direkte Einreichung bei der UKA ist nicht möglich.
Informationen über die UKA: www.anerkennung-kirche.de
Die Anerkennungszahlung liegt zwischen 1.000 € und 50.000 €, in besonders schweren Fällen auch darüber. Diese erhöhten Zahlungen werden gesondert zwischen der UKA und dem jeweiligen Bistum oder Orden vereinbart. Zahlungen, die beim ersten Verfahren vor 2021 geleistet wurden, werden von der neu berechneten Summe abgezogen.
Zusätzlich zu den Einmalzahlungen kann die Übernahme von Kosten einer Psychotherapie (bis zu 50 Stunden) und/oder einer Paartherapie (25 Sitzungen) beantragt werden. Diese werden nicht auf die Einmalzahlung angerechnet.
Betroffene, die bisher noch keinen Antrag auf Anerkennung des Leids (in der alten Version) gestellt haben, benutzen den Erstantrag in der
> handschriftlich Version oder
> elektronisch bearbeitbaren Version.
Die Ansprechpersonen können beim Antragsverfahren helfen und leiten die Anträge an den bischöflichen Beraterstab weiter. Dieser unterzieht den Antrag einer Prüfung auf Plausibilität.
Betroffene, die ein Verfahren zur Anerkennung des Leids vor dem 1. Januar 2021 durchlaufen haben (verbunden mit einem Gespräch mit der unabhängigen Ansprechperson im Bistum und einer bereits geführten Plausibilitätsprüfung), benutzen den erneuten Antrag
> handschriftliche Version oder
Da die Formulierung des Tatgeschehens und seiner Folgen schwer und retraumatisierend sein kann, finden Sie hier als Hilfestellung für den „Antrag auf Anerkennung des Leids“ eine Übersicht bzw. einen Ankreuzbogen, der den Kriterien der UKA folgt.
Die Informationen der Bischofskonferenz zur UKA, zum Ablauf und alle Anträge in der Übersicht finden Sie hier.
Bis zur Entscheidung durch die UKA können noch Ergänzungen vorgenommen und Unterlagen nachgereicht werden, wenn Betroffene dies für erforderlich halten, oder wenn weitere Unterlagen (z.B. Gutachten) zugegangen sind und weitere Aspekte eingebracht werden sollen.
Die UKA legt die Höhe der Zahlung fest und überweist den Betrag direkt an die Betroffenen. Wenn sich Betroffene selbst nicht in der Lage sehen, einen (erneuten) Antrag zu stellen, dann besteht die Möglichkeit, einen Vertreter mit Hilfe einer Vollmacht zu benennen.
Wenn Sie einen Antrag nach dem alten Verfahren (vor 2021) gestellt haben oder vermuten, dass das Bistum oder der Orden Unterlagen über Sie hat, können Sie ggf. vor einem erneuten Antrag eine Einsicht in die personenbezogenen Daten, die beim Bistum bzw. Orden zu Ihrem Fall hinterlegt sind und ggf. für die Begutachtung durch die UKA herangezogen werden, beantragen (Akteneinsicht bzw. Aktenkopie). Da die UKA das Archiv der alten Anträge vom VDD übernommen hat, können Sie auch dort einen entsprechenden Antrag auf Dateneinsicht in Ihre alten Anträge stellen.
Betroffene, die im Rahmen eines Ordens sexuellen Missbrauch erfahren haben, können über die Internetseite der Ordensobernkonferenz (DOK) ihren Leistungsanspruch ersehen. Eine Liste aller Orden, die die Ordnung der DBK adaptiert haben und Anerkennungszahlungen leisten wollen, und die zugehörigen Ansprechpersonen in den Orden finden Sie hier. Die Anträge für Ordensbetroffene finden Sie hier.
Freiwillige Leistungen der katholischen Kirche in Anerkennung des Leids werden weder als Einkommen noch als Vermögen bei der Berechnung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) berücksichtigt.
In Nr. 12 der Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids ist bestimmt, dass es den Betroffenen freisteht, auch nach Abschluss des Verfahrens den Antrag mit neuen Informationen der Kommission zur erneuten Prüfung vorzulegen.
Seit dem 1.3.2023 haben Betroffene zudem eine (kostenlose) Widerspruchsmöglichkeit mit Akteneinsicht. Der Widerspruch erfolgt über die Ansprechpersonen, die die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. Dabei wird die Höhe der Leistung überprüft. Eine Reduzierung der Zahlung ist ausgeschlossen.
Da das Kölner Urteil im Fall G. Menne mit der nun rechtskräftigen Zahlung von 300.000 Euro einen neuen Maßstab gesetzt hat und sich das UAK-Verfahren an staatlichen Zahlungen orientiert, ist zu
erwarten, dass sich die Zahlungen nun erhöhen. Ein Widerspruch kann somit sehr sinnvoll sein!
Ist die Entscheidung der UKA vor dem 1. März 2023 mitgeteilt worden, so gilt eine Widerspruchsfrist bis zum 31. März 2024. Ansonsten haben Betroffene zwölf Monate nach Eingang der Entscheidung Zeit, einen Widerspruch einzulegen. Ein erneuter Widerspruch ist nicht möglich. Eine Begründung des Widerspruchs ist nur schriftlich möglich. Anhörungen erfolgen nicht. Die Entscheidung über den Widerspruch wird schriftlich mitgeteilt – eine Begründung der Entscheidung erfolgt nicht.
Wenn ein Widerspruch ohne Akteneinsicht und ohne weitere Begründung eingelegt wird, dauert es nach aktuellem Stand ca. vier Monate bis zu einer erneuten Entscheidung. Bis zur Akteneinsicht dauert es ca. drei Monate. Zur Einsicht kann eine Vertrauensperson mitgenommen werden. Nach erfolgter Akteneinsicht
kann (nicht muss!) innerhalb von vier Wochen dem Widerspruch eine Begründung zugefügt werden. Nach diesen vier Wochen beginnt das eigentliche Widerspruchsverfahren, sodass im Ganzen wohl mit (derzeit) bis zu acht Monaten zu rechnen ist. Informationen unter: www.dbk.de
Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch im Original vorliegen muss, d. h. digitale Unterschriften (Scans etc.) werden durch die UKA aus rechtlichen Gründen nicht anerkannt. Nutzen Sie gerne diese Textvorlage für den Widerspruch!
Antrag nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV vorher OEG)
Nach dem früheren (staatlichen) Opferentschädigungsgesetz (OEG), das seit 1.1.2024 im SGB XIV aufgegangen ist, können Opfer von Gewalttaten Anspruch auf Entschädigung geltend machen (Heil- und Krankenbehandlung, Pflege- und Fürsorgeleistungen, Teilhabeleistungen etc.).
Seit dem 1.1.2024 können auch Opfer psychischer Gewalt, Opfer im Zusammenhang mit Kinderpornografie und Angehörige/Hinterbliebene Leistungen beantragen.
Neu sind das System der „Schnellen Hilfen“ (psychotherapeutische Erstversorgung in Trauma-Ambulanzen) und die Begleitung von Betroffenen im gesamten Entschädigungsverfahren durch Fallmanager:innen.
Hierfür gibt es die Onlinedatenbank ODABS u. a. mit Angeboten zu Trauma-Ambulanzen und der psychosozialen Prozessbegleitung.
Die monatlichen Entschädigungszahlungen wurden erhöht und auch Einmalzahlungen sind nun möglich.
Genauere Informationen finden Sie unter: www.bmas.de
Betroffene, die bereits Leistungen nach dem (alten) OEG erhalten, können in den neuen Leistungskatalog wechseln oder im alten verbleiben (Wahlrecht). Beantragt werden die Leistungen beim Versorgungsamt des Bundeslandes, in dem man wohnt.
Ein entsprechender Antrag erfolgt über das bundeseinheitliche Antragsformular erfolgen. Hierbei müssen Sie Ihre zuständige Versorgungsbehörde angeben, die Sie hier entnehmen können.
Weitere Informationen zur Antragstellung mit Erklärvideo.
Den vollständigen Gesetzestext zun Sozialen Entschädigung nach SGB XIV finden sie hier: www.gesetze-im-internet.de/sgb_14
Antrag beim Fonds Sexueller Missbrauch (FSM)
Der Fonds Sexueller Missbrauch gehört seit 01.01.2020 zum Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) und richtet sich an Betroffene sexualisierter Gewalt im familiären und institutionellen Bereich, die bis heute unter Folgeschäden des Missbrauchs leiden. Er kann für die Kosten aufkommen, wenn z. B. die Krankenkasse keine Psychotherapie mehr bewilligt oder Zuzahlungen zu Physiotherapien nicht bezahlt werden können. Auch andere Therapieformen, Qualifizierungsmaßnahmen (berufliche Fort-/Weiterbildung), medizinische Hilfsmittel oder Begleitungsleistungen (Haushaltsunterstützung, Behördengänge) werden unterstützt.
Pro Person können bis zu 10.000 Euro für diese Hilfen bewilligt werden; bei behinderungsbedingtem Mehraufwand weitere 5.000 Euro.
Leistungen aus dem Ergänzenden Hilfesystem (EHS), zu dem der FSM gehört, sind im institutionellen Bereich gegenüber den gesetzlichen Leistungen nachrangig. Das bedeutet, das EHS im institutionellen Bereich kann einspringen, wenn kein Anspruch aus dem bestehenden Hilfesystem besteht, diese Leistungen nicht ausreichen oder Leistungen abgelehnt wurden. Der Fonds finanziert sich aus dem Bundeshauhalt und aus Leistungen von Kooperationspartnern. Die Geschäftsstelle des FSM in Berlin nimmt grundsätzlich Anträge von allen Betroffenen sexualisierter Gewalt entgegen unter www.bafza.de.
Generelle Fragen zur Antragstellung können Sie unter 030 340 48481 bzw. 0800 400 10 50 oder unter Kontakt-FSM@bafza.bund.de stellen. Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter www.fonds-missbrauch.de.
Antrag nach SGB IX (GdB, Schwerbehindertenausweis)
Opfer von sexuellem Missbrauch können einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung bzw. Schwerbehinderung (ab GdB 50) nach SGB IX stellen. vgl. www.gesetze-im-internet.de 3.7 Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen.
Eine einfache Anleitung zur Beantragung finden Sie unter www.einfach-teilhaben.de.
Als (Schwer-)Behinderter haben Sie je nach Höhe des Grads der Behinderung Ansprüche auf Nachteilsausgleich wie z. B. steuerliche Vorteile, besonderen Kündigungsschutz, Zusatzurlaub, Rundfunkgebührenermäßigung etc.
Hinweise zu Ihren Rechten nach dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG)
- Nach dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) haben Sie Anrecht auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten – und somit u. a. das Recht auf Einsicht, Kopie, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten.
- Das KDG gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Datenverarbeitung sowie auch für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen (vgl. KDG § 2).
- „Übersetzt“ heißt dies, dass es sich auf jegliche Daten, die über Sie gespeichert, abgelegt bzw. abgeheftet sind (Protokolle, Berichte usw.), bezieht. Dieses Recht kann auch von bevollmächtigten Personen (z. B. Angehörigen) wahrgenommen werden – es muss eine entsprechende Vollmacht vorgelegt werden.
- Ihr Auskunftsrecht (§ 17 KDG) bezieht sich auf Ihre personenbezogenen Daten selbst, aber auch auf ihren Verwendungszweck, die Dauer der Speicherung etc. (§ 17 Abs. 1). „Gesundheitsdaten“ (Daten, die sich auf körperliche o. geistige Gesundheit beziehen, Daten zu Gesundheitsdienstleistungen etc.) fallen auch darunter (§ 4 Punkt 17).
- Sie haben das Recht, von diesen personenbezogenen Daten eine unentgeltliche Kopie anzufordern (§ 17 Abs. 3).
- Einen entsprechenden Antrag können Sie (oder eine bevollmächtigte Person) bei der zuständigen Stelle im Bistum (z. B. der Stabsstelle Intervention etc.) stellen.
- Die zuständige Stelle muss der betroffenen Person unverzüglich, aber spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang, Informationen zur Verfügung stellen (oder informiert die betroffene Person, warum eine Fristverlängerung, max. zwei weitere Monate, notwendig ist – mit Begründung!, und informiert sie über den Beschwerdeweg). (§ 14 Abs. 3 & 4)
- Sollte das Bistum seinen Verpflichtungen nach dem KDG nicht nachkommen (Fristverstreichung etc.), so können Sie Beschwerde bei der unabhängigen Datenschutzaufsicht, dem „Diözesandatenschutzbeauftragten“, einlegen. Diese Behörde ist „oberste Aufsichtsbehörde“, d. h. kirchliche Stellen müssen den Anweisungen Folge leisten. Eine bevollmächtigte Person braucht auch für das Einlegen dieser Beschwerde eine Vollmacht.
- Das KDG weist darüber hinaus etliche weitere Rechte aus, z.B. Weitergabe von Daten an Dritte etc. Diese können Sie im KDG nachlesen: www.kdsa-nord.de
Vorlage zum Antrag auf Einsicht und Kopie Ihrer personenbezogenen Daten
Unabhängige Ansprechpersonen
für Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im Erzbistum Hamburg und den Bistümern Hildesheim und Osnabrück
Gemäß der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst
Erzbistum Hamburg
Karin Niebergall-Sippel
Heilpädagogin
Frank Brand
Rechtsanwalt
Eilert Dettmers
Rechtsanwalt
Bettina Gräfin Kerssenbrock
Volljuristin
Christiane Bente
Krankenhausseelsorgerin und Pastorale Mitarbeiterin
Hendrik M. Rabbow
Theologe, Systemischer Coach und Seelsorger
Das Erzbistum Hamburg hat ein Büro für die unabhängigen Ansprechpersonen für Fragen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener in kirchlichen Einrichtungen eingerichtet:
Telefon: 0162 326 04 62
Bistum Hildesheim
Meike Heier
Dipl. Psychologin
Telefon: 0151 22725949
E-Mail: meike.heier@posteo.de
Dr. Alisia Sachse
Praktische Ärztin
Telefon: 0160 3304999
E-Mail: alisia.sachse@posteo.de
Hanspeter Teetzmann
Jurist
Telefon: 0151 27273563
E-Mail:
Bistum Osnabrück
Antonius Fahnemann
Landgerichtspräsident a. D.
Telefon: 0800 73 54 120
E-Mail: fahnemann@intervention-os.de
Olaf Düring
Diplom-Psychologe, Leiter der Beratungsstelle der AWO
Telefon: 0800 50 15 684
E-Mail: duering@awo-os.de
Kerstin Hülbrock
Diplom-Sozialpädagogin
Telefon: 0800 50 15 685
E-Mail: huelbrock@awo-os.de
Auswahl unabhängiger Kontakt- und Informationsstellen
Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen
Bischofskonferenz
Zielgruppen: Frauen, die als Erwachsene im Bereich von Kirche und Orden Gewalt erfuhren (insbes. auch Ordensschwestern) und ihre Angehörigen (derzeit auch offen für betroffene Männer)
Angebote: anonyme Online-Beratung, Vernetzungstreffen, Veranstaltungen
Zentrales Portal der Bundesregierung
Zielgruppen: Betroffene und Angehörige
Angebote: Hilfetelefon, Beratungsstellensuche, Therapieangebote, staatliche Hilfeleistungen usw.
Initiative der Bundesregierung
Zielgruppe: alle Ehren- und Hauptamtlichen, die in Einrichtungen und Organisationen mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben
Angebote: Information, Prävention, Schutzkonzepte usw.
Fachberatungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext des Vereins Umsteuern! Robin Sisterhood e.V. in Köln
Zielgruppe: Betroffene sexualisierter Gewalt
Angebote: Online-Beratung, Telefonberatung, Vermittlung juristischer und psychologischer Beratung, Begleitung
Zielgruppen: von sexualisierter Gewalt betroffene Jungen und männliche Jugendliche bis 27 Jahre
Angebote: geschützte Räume, professionelles Hilfsangebot
Verein gegen sexualisierte Gewalt und Fachberatungsstelle in Helmstedt
Zielgruppen: Betroffene sexualisierter Gewalt, deren Angehörige oder Kontaktpersonen
Angebote: Anlaufstelle für Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim; Beratung und Hilfe für Betroffene und Angehörige
Bundesweiter Opferhilfeverein
Zielgruppe: Opfer von Gewaltverbrechen
Angebote: Opfer-Telefon, Ansprechpartner in akuten Not- und Krisensituationen
Fachberatungsstelle in Oldenburg gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen
Zielgruppen: Mädchen und Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, deren Angehörige und Bezugspersonen
Angebote: Online-Beratung, telefonische und persönliche Beratung
Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Jungen und Mädchen
Unabhängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie (durchgeführt von der Fachberatungsstelle Pfiffigunde Heilbronn e.V.)
Zielgruppen: Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie
Angebote: kostenlose und anonyme telefonische Beratung (Schweigepflicht seitens der Beratenden), Vermittlung von kirchlichen Ansprechstellen oder unabhängiger Beratung, auf Wunsch Klärung der Zuständigkeitsbereiche kirchlicher Stellen etc.
Möchten Sie Ihr Schweigen brechen?
Wenn Sie das Bedürfnis haben, mit jemandem über Ihre Erfahrungen zu sprechen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Wir behandeln Ihre Geschichte vertraulich und geben keine Daten weiter, wenn Sie diese nicht ausdrücklich erlauben.
Literatur-Empfehlung
Selbsthilfe
- Croos-Müller, Claudia: Alles gut – Das kleine Übungsbuch Soforthilfe bei Belastung, Trauma & Co. (2017) | Kösel-Verlag | 72 Seiten | ISBN: 978-3466346660
- Croos-Müller, Claudia: Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co. (2012) | Kösel-Verlag | ISBN: 978-3466309450
- Reddermann, Luise / Dehner-Rau, Cornelia: Trauma verstehen, bearbeiten, überwinden: Ein Übungsbuch für Körper und Seele (2020) | Verlag TRIAS | 164 Seiten | ISBN: 978-3432111049
Betroffene berichten
- Pero, Franziska-Marie: Mein Ich im Wildwasser – Tagebuch einer Traumatherapie (2023) | Books on Demand | 260 Seiten | ISBN: 978-3756883004
- Haslbeck, Barbara (Hrsg) et. al.: Erzählen als Widerstand: Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche (2021) | Verlag Aschendorff | 272 Seiten | ISBN: 978-3402247426
- Probst, Alexander J. / Bachmann, Daniel O.: Von der Kirche missbraucht: Meine traumatische Kindheit im Internat der Regensburger Domspatzen und der furchtbare Skandal (2017) | Verlag Riva | 208 Seiten | ISBN: 978-3742303363
- Wagner, Doris: Nicht mehr ich: Die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau (2016) | Verlag Knaur | 336 Seiten | ISBN: 978-3426787922
- Tiede, Andreas: Einspruch nicht vorgesehen! - Eine Autobiografie zwischen klerikalem Missbrauch und Waffendienstverweigerung in der DDR (2023) | Verlag tredition (book on demand) | 352 Seiten | ISBN: 978-3347898479
- Gause, Ute: „Gott habe ihm gesagt, er solle mich zur Frau machen“ (2024) | Gütersloher Verlagshaus | 288 Seiten | ISBN: 978-3579072302
- Vogt, Bernd: Missbraucht im Namen des Herrn: Die Geschichte einer gestohlenen Kindheit in einer Evangelischen Freikirche (2020) | Books on Demand | 280 Seiten | ISBN: 978-3750459489
Schwerpunkt „Angehörige“
- Kriechel, Beate: Missbrauchtes Vertrauen. Wie sich sexualisierte Gewalt in der Kindheit auf Angehörige auswirkt (2023) | Mabuse-Verlag | 230 Seiten | ISBN: 978-3863216115
Spiritueller Missbrauch
- Wagner, Doris / Mertes, Klaus: Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche (2019) | Verlag Herder | 208 Seiten | ISBN: 978-3451384264
- Gentner, Ulrike u.a.: Spirituellen Missbrauch verhindern. Wegweiser für Prävention und Intervention (2025) | Echter | 260 Seiten | ISBN: 978-3429068097
- Haslbeck, Barbara u.a.: Selbstverlust und Gottentfremdung. Spiritueller Missbrauch an Frauen in der katholischen Kirche (2023) | Patmos | 304 Seiten | ISBN: 978-3843614757
- Leimgruber, Ute u. Haslbeck, Barbara: Spirituellen Missbrauch verstehen (2024) | Grünewald | 130 Seiten | ISBN: 978-3786733546
- Wagner, Doris: Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche (2019) | Herder | 208 Seiten | ISBN: 978-3451384264
Seelsorge und Spiritualität
- Kerstner, Erika / Haslbeck, Barbara / Buschmann, Annette: Damit der Boden wieder trägt - Seelsorge nach sexuellem Missbrauch (2016) | Schwalbenverlag | 240 Seiten | ISBN: 978-3796616938
- Stahl, Andreas: »Wo warst du, Gott?«: Glaube nach Gewalterfahrungen (2022) | Verlag Herder | 208 Seiten | ISBN: 978-3451393303
- Stahl, Andreas: Traumasensible Seelsorge: Grundlinien für die Arbeit mit Gewaltbetroffenen (Praktische Theologie heute, 163, Band 163) (2019) | Verlag W. Kohlhammer | 389 Seiten | ISBN: 978-3170374560
- Kirtsch, Ralph: Wandlungs-Räume: Praxishandbuch traumasensible Seelsorge (2021) | Verlag W. Kohlhammer | 321 Seiten | ISBN: 978-3170376854
Missbrauch und katholische Kirche
- Aschmann, Birgit (Hrsg.): „Katholische Dunkelräume - Die Kirche und der sexuelle Missbrauch“ (2021) | Brill/Schöningh | 273 Seiten | ISBN: 978-3506791214
- Hallay-Witte, Mary / Jannsen, Bettina (Hrsg.): „Schweigebruch: Vom sexuellen Missbrauch zur institutionellen Prävention“ (2015) | Herder | 336 Seiten | ISBN: 978-3451348365
- Hanstein, Thomas: „Von Hirten und Schafen: Missbrauch in der katholischen Kirche - Ein Seelsorger sagt Stopp“ (2019) | Tectum | 268 Seiten | ISBN: 978-3828843202
- Prüller-Jagenteufel, Gunther / Treitler, Wolfgang (Hrsg.): „Verbrechen und Verantwortung - Sexueller Missbrauch von Minderjährigen in kirchlichen Einrichtungen“ (2021) | Herder | 256 Seiten | ISBN: 978-3-451-38913-9
- Nagel, Regina / Lürbke, Hubertus (Hrsg.): Machtmissbrauch im pastoralen Dienst – Erfahrungen von Gemeinde- und Pastoralreferent:innen (2023) | Verlag Herder | 224 Seiten | ISBN: 978-3451398537
- Großbölting, Thomas: Die schuldigen Hirten: Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche (2022) | Verlag Herder | 288 Seiten | ISBN: 978-3451389986
- Katsch, Matthias: Damit es aufhört: Vom befreienden Kampf der Opfer sexueller Gewalt in der Kirche (2020) | Verlag Nicolai Publishing & Intelligence | 168 Seiten | ISBN: 978-3964760302
- Mertes, Klaus: Den Kreislauf des Scheiterns durchbrechen: Damit die Aufarbeitung des Missbrauchs am Ende nicht wieder am Anfang steht (2021) | Verlag Patmos | 80 Seiten | ISBN: 978-3843613491
- Reisinger, Doris / Röhl, Christoph: Nur die Wahrheit rettet: Der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger (2021) | Verlag Piper | 352 Seiten | ISBN: 978-3492070690
- Wagner, Doris / Kardinal Schönborn, Christoph: Schuld und Verantwortung: Ein Gespräch über Macht und Missbrauch in der Kirche (2019) | Verlag Herder | 128 Seiten | ISBN: 978-3451395260
- Frings, Bernhard u.a.: Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche (2022) | Herder | 592 Seiten | ISBN: 978-3451389955
- Hoyeau, Céline: Der Verrat der Seelenführer – Macht und Missbrauch in Neuen Geistlichen Gemeinschaften (2023) | Verlag | 296 Seiten | ISBN: 978-3451394218
- Kießling, Klaus: Geistlicher und sexueller Machtmissbrauch (2021) | Echter | 88 Seiten | ISBN: 978-3429056070
- Wensierski, Peter: Schläge im Namen des Herrn – Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik“ (2007) | Goldmann | 256 Seiten | ISBN: 978-3442129744
Weitere Literaturtipps
- Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs: Th. Großbölting, B. Janssen, H. Keupp, St. Rixen, M. Schmitz, U. Wast: „Rechtliche Aspekte der Aufarbeitung“